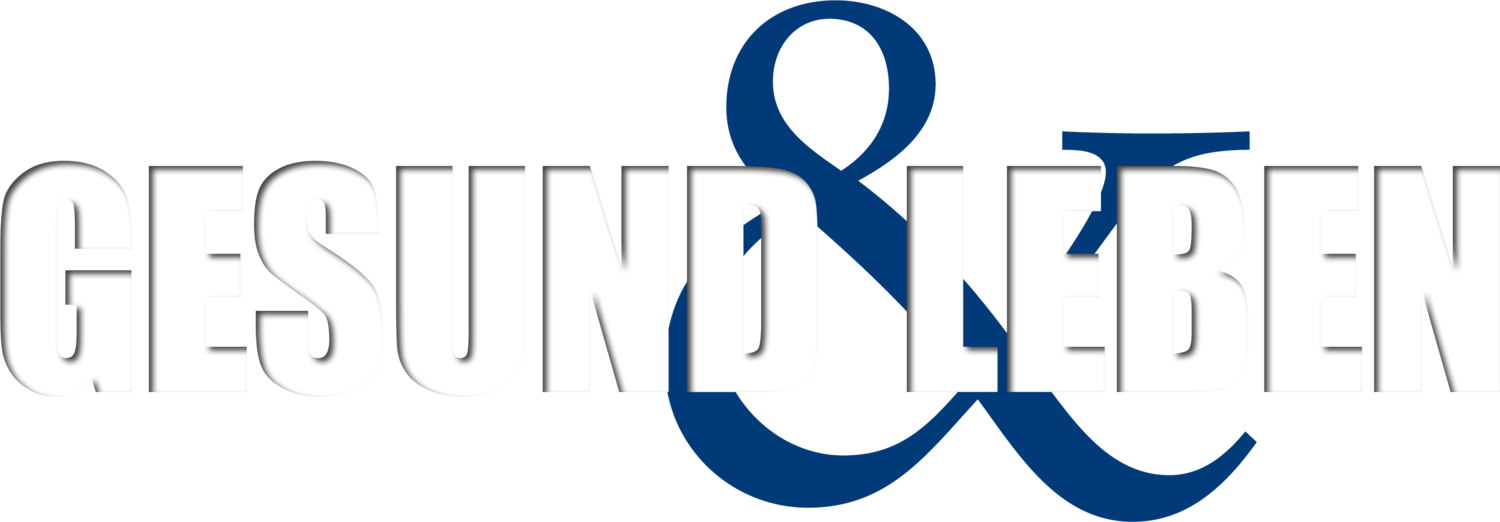Herzensangelegenheit
Mit „HerzMobil“ startet in Niederösterreich ein telemedizinisches Betreuungsprogramm.
Präsentierten das Projekt „HerzMobil NÖ“: (v.l.) Dr. Silvia Bodi, MSc (GF Gesundheit Thermenregion GmbH), Landesrat und NÖGUS-Vorsitzender Martin Antauer, Herzinsuffizienzberaterin DGKP Ulrike Materna, Oberarzt Dr. Martin Grübler (Innere Medizin II, Universitätsklinikum Wiener Neustadt), damaliger Landesrat Ludwig Schleritzko, NÖGUS-Geschäftsführer Mag. Volker Knestel, LGA-Vorständin Mag. jur. Dr. med. Elisabeth Bräutigam, MBA, Robert Leitner (Vorsitzender ÖGK-Landesstellenausschuss in NÖ), Dr. Harald Schlögel (Präsident NÖ Ärztinnen- und Ärztekammer), Prim. Univ.-Prof. Dr. Franz Xaver Roithinger, MSc (Vorstand Innere Medizin II am Universitätsklinikum Wiener Neustadt) und vorne sitzend Patient Karl Grandl
Rund 300.000 Menschen in Österreich leiden an einer chronischen Herzschwäche, allein in Niederösterreich kommt es jedes Jahr zu etwa 25.000 Klinikaufenthalten. Herzinsuffizienz gehört zu den häufigsten internistischen Erkrankungen. Dabei kann das Herz den Körper nicht mehr ausreichend mit Blut und Sauerstoff versorgen – die Folge sind Atemnot, eingeschränkte Belastbarkeit, Wassereinlagerungen und wiederholte Klinikaufenthalte. Karl Grandl kennt die Symptome nur zu gut. Der 82-Jährige leidet seit 15 Jahren an chronischer Herzinsuffizienz. Als einer der ersten Patientinnen und Patienten in Niederösterreich nahm er am Projekt „HerzMobil“ teil und wurde die vergangenen Monate digital betreut. Dafür wurde er mit einem Smartphone, einer Waage und einem Blutdruckmessgerät ausgestattet. Damit erfasst er täglich seine Gesundheitsdaten, die per App an das medizinische Team des Universitätsklinikums Wiener Neustadt übermittelt werden. „Am Anfang war es ein bisschen lästig, sich jeden Tag auf die Waage zu stellen und Puls zu messen, aber man gewöhnt sich daran“, so Grandl. Die App ist anwenderfreundlich und einfach zu bedienen, erläutert DGKP Ulrike Materna. Die erfahrene Pflegekraft ist Herzinsuffizienzberaterin und steht den Patientinnen und Patienten zur Seite – schult sie ein und überprüft täglich die Werte, die per App übermittelt werden. Bei Auffälligkeiten erfolgt eine rasche Rückmeldung durch das „HerzMobil“-Team im Klinikum. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der klinischen Abteilung für Innere Medizin II arbeiten für das Projekt sowohl ärztlich als auch pflegerisch Hand in Hand“, sagt Prim. Univ.-Prof. Dr. Franz Xaver Roithinger, MSc, Vorstand der Abteilung. Federführend für das Projekt verantwortlich ist Oberarzt Dr. Martin Grübler.
WEITERLESEN im ePaper ❯
Warnzeichen rechtzeitig erkennen
Ihr Körper sendet wichtige Signale. Wenn Sie Veränderungen rechtzeitig bemerken, können Sie gemeinsam mit Ihrem Betreuungsteam rasch handeln – und Schlimmeres verhindern. Achten Sie auf folgende Anzeichen und zögern Sie im Zweifel nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Kontaktieren Sie Ihre Hausärztin, Ihren Hausarzt, wenn eines der folgenden Symptome ohne erkennbare Ursache und trotz regelmäßiger Medikamenteneinnahme auftritt.
rasche Gewichtszunahme (z. B. 2 kg in 2 Tagen)
zunehmende Atemnot oder Husten im Liegen
Schwellungen an Beinen oder Bauch
Schwindel, Herzrasen, starkes Herzklopfen
Blutdruck über 180/110 mmHg
Bei akuten Beschwerden zögern Sie nicht, den Notruf 144 zu wählen!
HerzMobil NÖ
Moderne Betreuung – bequem von zuhause
„HerzMobil NÖ“ ist ein medizinisches Betreuungsprogramm für Menschen mit der chronischen Erkrankung Herzinsuffizienz – auch „Herzschwäche“ genannt. Sie werden für drei Monate von einem Team aus speziell ausgebildeten Pflegepersonen (Herzinsuffizienzberaterinnen und -berater), Ärztinnen und Ärzten begleitet. Mithilfe digitaler Geräte (Smartphone, Blutdruckgerät, Waage) übermitteln die Patientinnen und Patienten täglich ihre Gesundheitsdaten. So erkennt das Team im Klinikum frühzeitig Veränderungen und kann schnell reagieren. Die aktive Begleitung dauert in der Regel drei Monate. In dieser Zeit lernen die Patientinnen und Patienten mit ihrer Erkrankung besser umzugehen und gewinnen mehr Sicherheit im Alltag – und Vertrauen in ihren eigenen Körper. Am Ende der drei Monate findet ein pflegerisches und ärztliches Abschlussgespräch statt. Dabei werden Fortschritte besprochen, offene Fragen geklärt und weitere Schritte geplant. Bei Bedarf kann das Programm verlängert werden. Nach Programmende werden die Patientinnen und Patienten weiterhin von ihrem fach- oder hausärztlichen Team betreut.
Text: Karin Schrammel⎪Foto: Philipp Monihart