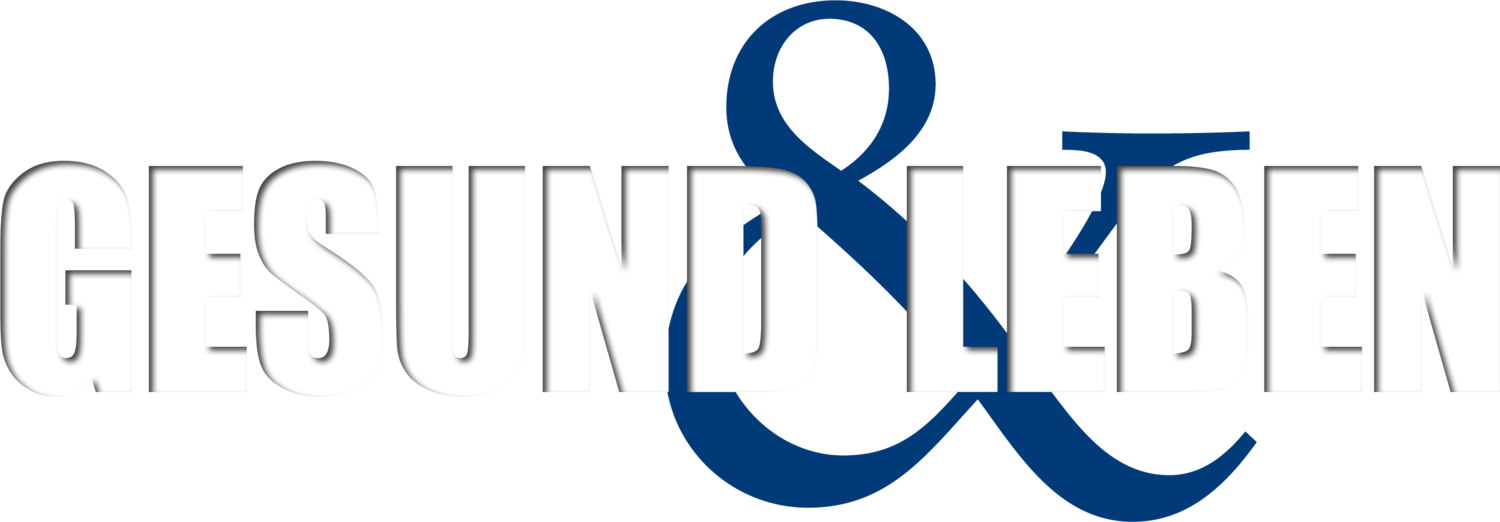„Ich bin nicht falsch, ich bin anders“
Warum neurodivergente Menschen oft unterschätzt werden – und was ihnen wirklich hilft, im Beruf aufzublühen.
Autismus, AD(H)S, Hochsensibilität – viele verbinden damit Herausforderungen. Doch neurodivergente Menschen bringen oft außergewöhnliche Fähigkeiten mit, die sie – unter den richtigen Bedingungen – zu wertvollen Kolleginnen und Kollegen, kreativen Köpfen oder brillanten Spezialisten machen. Eine neue Studie zeigt: Es braucht mehr als nur Talent. Entscheidend ist, ob das Umfeld bereit ist, Vielfalt zu verstehen – und zu ermöglichen.
Erfolg braucht passende Rahmenbedingungen
Anthony Hopkins, Greta Thunberg oder Mary Temple Grandin haben eines gemeinsam: Sie gelten als neurodivergent – und haben Außergewöhnliches geleistet. Und doch kämpfen viele Menschen mit Autismus, AD(H)S oder Hochsensibilität mit Vorurteilen, Hürden im Arbeitsleben und fehlender Unterstützung. Warum gelingt es manchen, beruflich durchzustarten, während andere aufgeben müssen?
Diese Frage stand im Zentrum einer qualitativen Studie von Dr. Eva-Maria Griesbacher. Zwischen März 2023 und Jänner 2024 führte sie 16 ausführliche Interviews mit neurodivergenten Erwachsenen und analysierte zusätzlich Online-Diskurse sowie Expertenstimmen.
Kindheit prägt die Berufschancen
„Die Weichen werden früh gestellt“, so Griesbacher. Kinder, die bedürfnisgerecht unterstützt werden, entwickeln eher ein stabiles Selbstbild und lernen, mit ihren Besonderheiten umzugehen. Fehlt diese Unterstützung, kann das gravierende Folgen für die spätere Berufslaufbahn haben – von sozialem Rückzug bis hin zu psychischen Erkrankungen.
In Österreich mangelt es laut Studie oft an individuell passenden Angeboten. Viele öffentliche Hilfen sind zu wenig differenziert. Besser schneiden oft Selbsthilfegruppen oder private Unterstützungsangebote ab – allerdings nur für jene, die sich das leisten können. Kinder aus einkommensschwächeren Familien haben es dadurch deutlich schwerer.
Zwischen Anpassung und Erschöpfung
Ein zentrales Ergebnis der Studie: Beruflicher Erfolg hängt bei neurodivergenten Menschen stark davon ab, ob sie ihre eigenen Stärken erkennen, ihre Bedürfnisse ausdrücken – und ein Arbeitsumfeld finden, das diese akzeptiert. Wer gezwungen ist, ständig „mitzuspielen“ und sich an unrealistische Normen anzupassen, riskiert Burnout, Depression oder Rückzug.
Neurodivergente Menschen, die erfolgreich im Beruf sind, erzählen häufig von positiven Vorbildern in der Familie, von offenen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern oder davon, dass sie gelernt haben, ihre Besonderheiten nicht als Schwäche, sondern als Stärke zu verstehen.
Medien machen Meinung
Auch die öffentliche Wahrnehmung spielt eine Rolle. Wenn in Medien oder sozialen Netzwerken vor allem Defizite betont werden, prägt das nicht nur die Sichtweise potenzieller Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, sondern auch das Selbstbild der Betroffenen. Positivbeispiele, differenzierte Berichterstattung und der Einbezug neurodivergenter Stimmen könnten viel verändern – doch noch fehlt es an Vielfalt im Diskurs.
Zugleich warnt die Studie vor digitalen Filterblasen: Wer sich nur in einseitigen Online-Communities bewegt, bekommt wenig Kontakt mit anderen Perspektiven. Algorithmen verstärken diese Wirkung – und verhindern echten Austausch. Dabei braucht es gerade bei einem so sensiblen Thema wie Neurodivergenz mehr Zuhören, mehr Verständnis, mehr Vielfalt. Die Ergebnisse zeigen klar: Neurodivergenz ist keine Einbahnstraße ins Scheitern – im Gegenteil. Mit dem richtigen Umfeld, einem bewussten Umgang mit eigenen Bedürfnissen und mehr gesellschaftlicher Offenheit können neurodivergente Menschen beruflich aufblühen.
Text: Daniela Rittmannsberger | Fotos: istock Glopphy